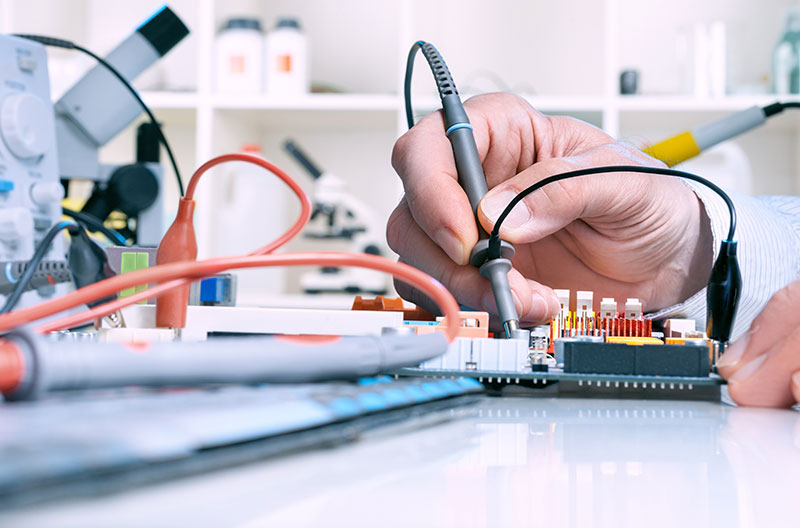Planung und Einrichtung einer Melag Aufbereitungseinheit (AEMP) für die Arztpraxis

Die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Qualitätssicherung in jeder Arztpraxis, die wiederverwendbare Instrumente einsetzt. Ohne eine normkonforme und lückenlos dokumentierte Aufbereitung können die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt und die Patientensicherheit nicht gewährleistet werden. Dies gilt unabhängig von der Fachrichtung – von Gynäkologie, Ophthalmologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Chirurgie und ambulanten OP-Zentren bis hin zu dentalen Einrichtungen wie Zahnarztpraxen, Kieferorthopädie und Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie. Die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) ist dabei nicht nur ein Raum, sondern eine zentral organisierte Funktionseinheit innerhalb der Praxis. Sie ist das Bindeglied zwischen Nutzung und erneuter Bereitstellung von Instrumenten und sorgt dafür, dass ein reibungsloser Kreislauf aus Reinigung, Desinfektion, Sterilisation und Freigabe eingehalten wird.
Inhaltsverzeichnis - Aufbereitungseinheit Arztpraxis - Planung, Einrichtung
Kernpunkte / Funktion der AEMP
Eine funktionierende AEMP trägt entscheidend zur Effizienz des Praxisbetriebs bei: Durch standardisierte, dokumentierte und validierte Arbeitsprozesse werden Fehlerquellen minimiert, Behandlungsverzögerungen vermieden und Hygienerisiken wirksam reduziert. Die räumlichen, technischen und organisatorischen Strukturen sind so anzulegen, dass sie jederzeit den Anforderungen der RKI-/KRINKO-Empfehlungen, MPBetreibV, des MPDG und weiterer einschlägiger Normen entsprechen.
- Kontinuierliche Instrumentenversorgung gewährleisten
- Kreuzkontaminationen systematisch verhindern
- Hygienische Richtlinien konsequent umsetzen
- Qualitätsgesicherte Aufbereitungsprozesse etablieren
- Patientensicherheit durch sterile Instrumente
- Standardisierte Arbeitsabläufe implementieren
- Rechtskonforme Betriebsführung sicherstellen
- Verschiedene Instrumententypen sachgerecht aufbereiten
Rechtliche und normative Grundlagen
Relevante Rechtsgrundlagen:
- Bauordnungsrechtliche Bestimmungen beachten
- Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften befolgen
- RKI Hygieneanforderungen implementieren
- Medizinprodukterecht und Durchführungsbestimmungen einhalten
- Technische Normen für Geräteausstattung
- Fachverbands-Richtlinien zur Instrumentenaufbereitung
- Berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigen
- Regionale Auslegungsunterschiede prüfen

Die Einrichtung und der Betrieb eines Aufbereitungsraums sind streng reglementiert. Grundlage ist das Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) in Verbindung mit der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR). Diese Rechtsrahmen legen fest, dass Medizinprodukte nur in einem sicheren, validierten Verfahren aufbereitet werden dürfen und dass dieser Prozess jederzeit nachvollziehbar dokumentiert sein muss.
Ergänzt werden diese gesetzlichen Grundlagen durch die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI). Diese enthalten detaillierte hygienische Mindestanforderungen, die bundesweit für alle Betreiber von Aufbereitungseinheiten gelten. Sie haben zwar formal den Charakter von Empfehlungen, sind jedoch faktisch verpflichtend, da die Nichteinhaltung im Schadensfall als Abweichung vom Stand der Technik gewertet werden kann.
Darüber hinaus bestimmen die Landesbauordnungen die baulichen Rahmenbedingungen, etwa in Bezug auf Raumgrößen, Belüftung, Materialwahl und Brandschutz. Das Arbeitsschutzrecht mit der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) regelt, wie Arbeitsplätze sicher gestaltet sein müssen. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV) fügen branchenspezifische Regelungen hinzu, beispielsweise zu Gefahrstoffen oder zur Ergonomie.
Die technische Ausstattung und Prozessvalidierung werden durch Normen wie DIN EN ISO 17665 (Sterilisation mit feuchter Hitze), DIN EN 13060 (Klein-Sterilisatoren) und DIN EN 285 (Groß-Sterilisatoren) definiert. Fachverbände wie DGKH, DGSV oder DEGEA liefern praxisorientierte Richtlinien für die Umsetzung.
Obligatorische Raumpflicht für Aufbereitungseinheiten
Kriterien für die Aufbereitungseinheit:
- Separater Raum bei Neu-, Zu- und Umbauten erforderlich
- Bestehende Praxen sollten nachrüsten
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen
- Kontrolle über Aufbereitungsqualität behalten
- Flexibilität bei Behandlungsabläufen gewährleisten
- Unabhängigkeit von externen Anbietern sichern
- Instrumentenaufkommen berücksichtigen

Die Medizinprodukte in medizinischen Einrichtungen müssen sachgerecht aufbereitet werden. Die Instrumentenaufbereitung kann entweder in der eigenen Praxis erfolgen oder an einen externen Dienstleister ausgelagert werden. Erfolgt die Aufbereitung der Medizinprodukte in der Praxis, so ist dafür bei Neu-, Zu- und Umbauten – und möglichst auch in bestehenden Praxen – ein eigener Dekontaminationsraum erforderlich. Eine Entscheidung über den Einsatz von Mehrweg-Instrumenten und die Einrichtung einer eigenen Aufbereitungseinheit hängt von verschiedenen strategischen und wirtschaftlichen Faktoren ab. Praxen mit hohem Instrumentenaufkommen, beispielsweise bei operativen Eingriffen oder endoskopischen Untersuchungen, profitieren meist von eigenen Aufbereitungskapazitäten. Die direkte Kontrolle über Aufbereitungsqualität und -zeiten ermöglicht flexible Behandlungsabläufe und reduziert Abhängigkeiten von externen Dienstleistern.

Aufbereitungseinheit – räumliche Konzeption mit Zonen
Der Aufbereitungsraum muss über ausreichende Flächen verfügen, um die Trennung in einen unreinen und einen reinen Bereich zu ermöglichen. Eine Kreuzung beider Bereiche muss zwingend ausgeschlossen werden. Bei der Planung der AEMP gibt es klare Vorgaben. Die RKI-Richtlinie schreibt unter anderem vor, dass eine nachvollziehbare Trennung von rein und unrein erfolgen muss. Die räumliche Konzeption muss die unterschiedlichen Instrumentenarten und deren Aufbereitungsanforderungen berücksichtigen. Komplexe Instrumentensets, beispielsweise bei operativen Eingriffen, benötigen größere Sortierflächen als einfache Untersuchungsinstrumente. Endoskopische Instrumente erfordern spezielle Aufbereitungsbereiche mit besonderen Anschlüssen. Mikrochirurgische Instrumente benötigen geschützte Bereiche zur Vermeidung von Beschädigungen durch Vibrationen oder unsachgemäße Handhabung. Ausreichender Platz für die sachgerechte Entsorgung klinischer Abfälle muss bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden, um kontaminierte Materialien sicher und regelkonform zu entsorgen.
Konzeptionelle Anforderungen an die Zonentrennung:
- Unreinen und reinen Bereich separieren
- Kreuzung der Bereiche ausschließen
- Fortlaufende Aufbereitung von unrein zu rein
- Flächendimensionierung nach Instrumentenaufkommen
- Spezielle Bereiche für endoskopische Aufbereitung
- Geschützte Zonen für empfindliche Instrumente
- Komplexe Instrumentensets effizient handhaben
- Ausreichend Platz für klinische Abfallentsorgung


Unreine Seite
Im unreinen Bereich befinden sich die Anlieferungszone, der Thermodesinfektor sowie bei Bedarf ein Arbeitsplatz für die manuelle Aufbereitung.

Reine Seite
Im reinen Bereich befinden sich die Kontrollfläche zur RDG-/Thermodesinfektor-Entladung, Funktionsprüfung und Sortierung sowie das Siegelgerät, der Autoklav und die Dokumentationseinheit.
Standortoptimierung und Wegekonzept der Aufbereitungseinheit
Aufbereitungseinheit – Standort-Checkliste:
- Räumliche Trennung von Patienten- und Materialwegen
- Zentrale Positionierung bei mehreren Behandlungsräumen
- Direkte, kurze Wege zu OP- und Endoskopie-Bereichen
- Separate Materialkorridore für chirurgische Praxen
- Breite, hindernisfreie Transportwege
- Einbahnstraßen-Prinzip im Materialfluss
- Vermeidung von Kreuzungspunkten zwischen rein und unrein

Die Position der Aufbereitungseinheit innerhalb einer Arztpraxis hat unmittelbaren Einfluss auf Effizienz, Hygiene und Arbeitskomfort. Ein klug gewählter Standort reduziert nicht nur Transportzeiten, sondern minimiert auch das Risiko von Kontaminationen beim Instrumententransport. Die Wegeplanung ist daher ein zentraler Bestandteil der AEMP-Gesamtplanung.
Grundprinzip: Trennung von Patienten- / Materialwegen
Der Aufbereitungsraum muss räumlich klar von allen Behandlungs- und Patientenbereichen getrennt sein. Kurze, direkte Wege zwischen Behandlungsräumen, OP-Bereich und AEMP sorgen für schnelle Umläufe, ohne dass sich Patienten- und Materialtransportwege kreuzen. So wird die Gefahr der Rekontamination oder der Störung des Praxisbetriebs verringert.Zentrale Lage und Erreichbarkeit
In Praxen mit mehreren Behandlungs- oder Eingriffsräumen sollte der Aufbereitungsraum zentral positioniert werden, um alle Funktionsbereiche gleich gut zu erreichen. Für Einrichtungen mit hohem chirurgischem Anteil bietet sich eine direkte Anbindung an den OP-Bereich an – idealerweise über einen separaten Materialkorridor. Endoskopie-Einheiten profitieren von besonders kurzen Wegen, da empfindliche Endoskope zeitnah und ohne Umwege zur Aufbereitung gebracht werden müssen.Logistische Effizienz
Ein gut geplantes Wegekonzept berücksichtigt das tägliche Instrumentenvolumen, die Transporthäufigkeit und die verschiedenen Instrumentengruppen. Beschickungswagen, Transportcontainer oder spezielle Endoskop-Transportboxen müssen sich ohne Engstellen bewegen lassen. Breite, hindernisfreie Transportwege sind daher unverzichtbar.
Wo möglich, sollte ein Einbahnstraßenprinzip im Materialfluss umgesetzt werden: kontaminierte Instrumente gelangen ausschließlich in den unreinen Bereich, während aufbereitete, sterile Instrumente den reinen Bereich verlassen – ohne Kreuzung dieser Ströme.
Beleuchtungskonzept und Lichtverhältnisse
Beleuchtungsanforderungen einer Aufbereitungseinheit:
- Direkte Sichtverbindung nach außen anstreben
- Innenliegende Räume mit Behörde abstimmen
- Oberlichter für natürliches Tageslicht nutzen
- Ausreichende Helligkeit nach DIN-Normen
- Blendfreie Beleuchtung durch matte Leuchtmittel
- Neutrale Farbtemperatur mit 4000 Kelvin
- Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schattenbildung
- Leicht zu reinigende Beleuchtungskörper

Ein AEMP als Dauerarbeitsplatz sollte eine direkte Sichtverbindung nach außen haben. Manchmal muss dieser aber als innenliegender Raum geplant werden, dann sollte man dies mit der zuständigen Aufsichtsbehörde abstimmen. Mit Oberlichtern oder einer Glastüre mit folierter milchiger Sichtabsperrung kann Tageslicht in den Raum gelangen.
Die Beleuchtung in der Aufbereitungseinheit ist für alle Fachrichtungen gleichermaßen entscheidend für einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf. Sie muss sowohl ausreichend hell als auch blendfrei sein, um eine optimale Sichtbarkeit bei der Aufbereitung von Medizinprodukten zu gewährleisten. Eine visuelle Kontrolle der aufbereiteten Medizinprodukte und die Prüfung auf Beschädigungen erfordern unabhängig von der Fachrichtung identische Beleuchtungsqualität. Reflexionen auf Arbeitsflächen müssen vermieden werden, um Ermüdungserscheinungen der Augen vorzubeugen.
Die Beleuchtungsstärke sollte den Anforderungen der DIN EN 12464-1 entsprechen. Eine blendfreie Beleuchtung durch matte oder opale Leuchtmittel ist anzustreben. Die neutrale Farbtemperatur von etwa 4000 Kelvin ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe und erleichtert die Unterscheidung von Farben bei der Instrumentenkontrolle. Die gleichmäßige Verteilung der Beleuchtung im Raum verhindert Schattenbildung.
AEMP Belüftungssysteme und Raumklima
Klimatechnische Systemanforderungen in der Aufbereitungseinheit:
- Mechanischer Luftwechsel 6 bis 12 Mal (Std.)
- Hochleistungsfilterung H13 Standard
- Arbeitsplatztemperatur 21 bis 23 Grad
- Relative Luftfeuchte 40 bis 60 Prozent
- Differenzdruck zwischen Funktionszonen
- Lokale Absaugung für Chemikaliendämpfe
- Integrierte raumlufttechnische Gesamtsysteme
- Dokumentierte Wartungs- und Überwachungsprotokolle

Die Luftqualität in Aufbereitungsräumen hat unmittelbaren Einfluss auf die Arbeitsplatzergonomie, die Prozesssicherheit und den Infektionsschutz. Chemische Dämpfe aus Desinfektionslösungen oder Reinigungsmitteln können die Atemwege belasten und müssen wirksam abgeführt werden. Zusätzlich gilt es, die Luft von mikrobiologischen Partikeln freizuhalten, um eine Rekontamination bereits aufbereiteter Instrumente zu verhindern.
Natürliche Belüftung und Insektenschutz
Wenn der Aufbereitungsraum über Fensterlüftung verfügt, ist ein wirksamer Insektenschutz zwingend erforderlich, um das Eindringen von Partikeln, Insekten und anderen Verunreinigungen zu verhindern. Fensterlüftung allein ist in der Regel jedoch nicht ausreichend, um die geforderte Luftqualität konstant zu gewährleisten.Mechanische Lüftungssysteme
Eine technische Raumlüftung mit geregeltem Luftwechsel ist die optimale Lösung für die Aufbereitungseinheit. Ein sechsfacher bis zwölffacher Luftwechsel pro Stunde sorgt für eine kontinuierliche Abführung belasteter Luft. Hochleistungs-Partikelfilter der Klasse H13 (HEPA-Filter) entfernen 99,95 % aller Partikel ≥ 0,3 µm aus der Zuluft. Dadurch werden luftgetragene Mikroorganismen und Schwebstoffe wirksam minimiert. Bei der Umrüstung eines vorhandenen Raumes zur AEMP bieten nachrüstbare Luftreiniger eine brauchbare Alternative.Raumklima und Komfort
Ein optimales Arbeitsklima liegt bei 21 bis 23 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %. Diese Werte bieten nicht nur angenehme Arbeitsbedingungen, sondern verhindern auch Materialschäden wie Korrosion oder das schnelle Austrocknen empfindlicher Materialien.Druckverhältnisse und Absaugtechnik
Differenzdrucksysteme zwischen unreiner und reiner Zone verhindern, dass Luft aus dem unreinen Bereich in den reinen Bereich strömt. Punktuelle Absaugungen an Reinigungsbecken oder bei der Dosierung von Chemikalien erfassen Schadstoffe direkt an der Quelle.Technische Infrastruktur und Anschlüsse
Erforderliche technische Anschlüsse:
- Elektrische Anschlüsse verschiedener Spannungen (230/400V)
- Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasser
- Instrumentenwaschbecken mit berührungsfreier Armatur
- Hochreine Wasserversorgung für Endoskopie etc.
- Datenverbindungen für Dokumentationssysteme
- Schutzschalter für elektronische Aufbereitungsgeräte
- Zugängliche Wasserabsperrventile für das Personal

Die Aufbereitungseinheit benötigt eine präzise geplante technische Infrastruktur, um die hohen hygienischen Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Dabei geht es um eine Kombination aus elektrischen, wasserführenden, druckluft- und datenbasierten Versorgungsleitungen.
Stromversorgung
Neben normalen Steckdosen (230 V) sind in der Regel Starkstromanschlüsse (400 V) für Thermodesinfektoren und große Dampfsterilisatoren notwendig. Spezielle Spannungen oder Absicherungen können bei bestimmten Ultraschallgeräten oder EDV-Komponenten erforderlich sein.Wasserversorgung
Für die Reinigung von Instrumenten wird kaltes und warmes Trinkwasser benötigt. Endoskopische Aufbereitungsgeräte benötigen zum Beispiel zusätzlich eine Versorgung mit hochreinem Wasser (VE- oder Osmosewasser), um Ablagerungen und Funktionsstörungen zu vermeiden. Die Leitungsführung sollte kurz und leicht zugänglich für Wartungen sein.Abwasser
Das Abwassersystem muss den spezifischen Anforderungen der Instrumentenaufbereitung entsprechen und verschiedene Abwasserarten berücksichtigen. Dazu gehören Reinigungswasser von Instrumenten, Spülwasser aus Desinfektionsgeräten sowie Reinigungswasser von Böden etc. Beispielsweise ist bei großen Anlagen ein Bodenablauf oder eine spezielle Hebeanlage erforderlich. Die Planung des Abwassersystems muss örtliche Vorschriften und praxisspezifische Anforderungen berücksichtigen, da je nach Region unterschiedliche Bestimmungen für die Entsorgung von medizinischem Abwasser gelten können.Sanitäre Einrichtungen
Ein Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasser ist für die persönliche Hygiene vorgeschrieben. Bei zusätzlicher manueller Aufbereitung ist ein separates Instrumentenwaschbecken mit berührungsloser Armatur notwendig, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.Druckluft und Datenleitungen
Druckluftanschlüsse werden für pneumatische Instrumente und Trocknungsprozesse benötigt, diese lassen sich auch optimal durch mobile Kompressorstationen nachrüsten. Datenverbindungen sind notwendig für Dokumentationssysteme, Gerätevernetzungen und Prozessfreigaben.Oberflächenbeschaffenheit und Materialauswahl
Materialanforderungen für Aufbereitungseinheiten:
- Abwaschbare Wände und Böden
- Desinfektionsmittelbeständige Oberflächen
- Fugenlose Oberflächengestaltung bevorzugen
- Beständigkeit gegen Reinigungschemikalien
- Antistatische Eigenschaften bei elektronischen Geräten
- Korrosionsresistente Einrichtungsgegenstände
- Rutschfeste Bodenbeschichtung
- Dampfbeständige Materialien bei Sterilisation

In der Aufbereitungseinheit sind Oberflächen besonderen Belastungen ausgesetzt – sowohl mechanisch als auch chemisch. Wände, Böden, Arbeitsflächen und Möbel müssen daher leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und langlebig sein.
Wände und Böden
Wände sollten glatt, fugenarm und mit abwaschbaren Beschichtungen versehen sein. Böden müssen rutschfest, wasserdicht und ebenfalls leicht zu reinigen sein. Fugenlose Beläge wie verschweißte PVC- oder Kautschukböden reduzieren Schmutz- und Keimnischen.Arbeitsflächen
Arbeitsflächen in der Aufbereitungseinheit bestehen idealerweise aus Edelstahl oder einem hochbeständigen Kunststoff. Bei besonderer Belastung ist Edelstahl die erste Wahl, da es korrosionsfest und hitzebeständig ist und häufige Desinfektionszyklen besonders gut verträgt.Sensible Umgebungen
Antistatische Eigenschaften sind bei Arbeitsplätzen mit sensiblen elektronischen Geräten wichtig. In Bereichen mit Dampferzeugung müssen Materialien dampfbeständig sein.Arbeitsflächengestaltung und Instrumentenlogistik
Arbeitsflächenkonzept und organisatorische Anforderungen:
- Ausreichende Arbeitsflächen nach Instrumentenaufkommen
- Große Sortierflächen für operative Instrumentensets
- Spezielle Halterungen für endoskopische Instrumente
- Vibrationsfrei gelagerte Flächen für Mikroinstrumente
- Modulare Systeme für flexible Anpassung
- Verwechslung verschiedener Instrumentenstatus verhindern
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Materialflussorientierte Anordnung

Die Anordnung und Dimensionierung der Arbeitsflächen in einer Aufbereitungseinheit hat entscheidenden Einfluss auf die Effizienz der Aufbereitung. In der unreinen Zone müssen Flächen vorhanden sein, um kontaminierte Instrumente aufzunehmen, zu sortieren und für den Reinigungsprozess vorzubereiten.
Instrumentenspezifische Anforderungen
Komplexe OP-Sets erfordern große Sortierflächen. Endoskopische Instrumente benötigen Halterungen, um Beschädigungen während der Reinigung zu vermeiden. Mikroinstrumente müssen vibrationsfrei gelagert werden.Ergonomie und Organisation
Eine logische Anordnung der Arbeitsflächen entlang des Prozessflusses – von der Anlieferung bis zur Freigabe – reduziert unnötige Wege und Bewegungen. Modulare Systeme erlauben eine flexible Anpassung an veränderte Anforderungen.Geräteplanung und Dimensionierung
Wesentliche Kriterien für die Geräteplanung:
- Untersuchungsspektrum und Instrumentenarten
- Behandlungsfrequenz und tägliches Instrumentenvolumen
- Anzahl der Behandler und OP-Termine
- Spezielle Anforderungen für Endoskopie oder Mikrochirurgie
- Ultraschallreiniger für empfindliche Instrumente
- Großvolumige Sterilisatoren für OP-Sets
- Redundanz bei kritischen Geräten zur Ausfallsicherheit
- Gute Zugänglichkeit für Wartungs- und Validierungsarbeiten

Die Auswahl und Dimensionierung der Geräte in einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit, Prozesssicherheit und Effizienz des gesamten Systems. Sie muss sich am Behandlungsspektrum, der Instrumentenanzahl, den Hygieneanforderungen sowie den rechtlichen Vorgaben orientieren. Eine zu geringe Kapazität führt zu Engpässen und Zeitdruck, eine überdimensionierte Ausstattung verursacht unnötige Kosten und erhöht den Wartungsaufwand.
Thermodesinfektoren (RDG)
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sind das zentrale Element der maschinellen Instrumentenaufbereitung. Die Auswahl richtet sich nach der täglichen Instrumentenmenge, der Bauform (Tischgerät oder Unterbaugerät) und den Anschlussmöglichkeiten. RDGs mit aktiver Trocknung erhöhen die Effizienz bei hohem Durchsatz.- Semikritische Medizinprodukte – Instrumente, die mit Schleimhäuten in Kontakt kommen, wie Spiegel oder bestimmte Endoskope – sollten in einem validierten Thermodesinfektor aufbereitet werden. Nach diesem Schritt ist keine zusätzliche Sterilisation erforderlich, sofern das Gerät die vollständige Reinigung und Desinfektion sicherstellt.
- Kritische Medizinprodukte – Instrumente, die in Körperbereiche eindringen, wie chirurgische Bestecke oder Implantationsinstrumente – müssen zwingend maschinell im Thermodesinfektor aufbereitet werden. Anschließend ist eine Sterilisation (autoklavieren) vorgeschrieben.
Sterilisatoren / Autoklaven
Sterilisatoren stellen den finalen Schritt in der Aufbereitungskette dar, sofern Instrumente sterilisiert werden müssen. Wichtige Kriterien sind die Zyklusdauer, Energieeffizienz, Wasserversorgung (Leitungswasser oder VE-Wasser) sowie die Möglichkeit der automatischen Dokumentation der Prozessdaten.- Kleinsterilisatoren nach DIN EN 13060 sind ideal für kleinere Praxen oder Abteilungen mit geringem Sterilgutaufkommen.
- Großsterilisatoren nach DIN EN 285 bieten deutlich höhere Kapazitäten und sind für Einrichtungen mit großem OP- oder Instrumentenvolumen geeignet.
Ultraschallreiniger und Spezialgeräte
Ultraschallbäder sind unverzichtbar für die gründliche Reinigung von komplex geformten Instrumenten, feinen Gelenken oder schwer zugänglichen Bereichen. Für flexible und starre Endoskope kommen spezialisierte Endoskop-Aufbereitungsgeräte zum Einsatz, die sowohl die mechanische Reinigung als auch die chemische Desinfektion unter kontrollierten Bedingungen übernehmen.Planungs- und Dimensionierungsfaktoren
Eine durchdachte Geräteplanung vermeidet Engpässe, Leerlaufzeiten und unnötige Doppelbelastungen. Neben der reinen Leistungsfähigkeit spielen auch Wartungsfreundlichkeit, Ergonomie und die Integration in digitale Dokumentationssysteme eine wichtige Rolle.
Medizintechnik mieten
Hier erfahren Sie mehr zum innovativen Flexkonzept – Thermodesinfektoren und Autoklaven etc. mieten – einfach, unbürokratisch und schnell abschließen.
Sterilgutlagerung und Instrumentenmanagement
Kernanforderungen an Sterilgutlagerung und -logistik:
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Lagerung
- Separate Aufbewahrung nach Instrumentengruppen
- Hängesysteme für empfindliche Endoskope
- Trockene, gut belüftete Lagerräume
- Klare Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- Geschlossene Transportbehälter für sterile Sets
- Schneller Zugriff auf Notfallinstrumentarien
- Logistikkette ohne Unterbrechung des Sterilstatus

Die sachgerechte Lagerung von Sterilgut ist ein zentraler Baustein in der Aufbereitungskette und hat unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit medizinischer Behandlungen. Selbst perfekt aufbereitete und freigegebene Instrumente verlieren ihren Status als sterile Medizinprodukte, wenn sie unsachgemäß gelagert oder transportiert werden. Ziel ist es, jede Rekontamination zuverlässig zu verhindern und gleichzeitig eine reibungslose, praxisgerechte Logistik zu gewährleisten.
Schutz vor Kontamination und Umwelteinflüssen
Sterile Instrumente müssen vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und mechanischen Beschädigungen geschützt werden. Lagerbereiche dürfen nicht in Durchgangszonen oder in unmittelbarer Nähe zu Wasseranschlüssen liegen, um das Risiko einer Verunreinigung zu minimieren. Für empfindliche Instrumente wie Endoskope bieten sich spezielle Schränke mit geschlossenen, staubdichten Türen an. Häufig werden hierfür Edelstahl- oder hochwertige, desinfektionsmittelbeständige Kunststoffoberflächen gewählt, um die Reinigung zu erleichtern.Geeignete Lagerbedingungen
Die Lagerumgebung sollte trocken und gut belüftet sein. Staubfilter an Belüftungsöffnungen verhindern das Eindringen von Partikeln. Eine konstante Raumtemperatur und moderate Luftfeuchtigkeit schützen Verpackungsmaterialien vor Feuchtigkeitsaufnahme oder Versprödung. Offene Regalsysteme sind nur dann geeignet, wenn sie in einem vollständig geschlossenen Raum mit kontrollierter Luftqualität stehen.Organisatorische Trennung und Rückverfolgbarkeit
Ein durchdachtes Logistikkonzept sieht vor, sterile und unsterile Medizinprodukte räumlich strikt zu trennen. Unterschiedliche Instrumentengruppen – beispielsweise für allgemeine Untersuchungen, chirurgische Eingriffe oder endoskopische Anwendungen – werden in eigenen, klar gekennzeichneten Bereichen gelagert. Eine lückenlose Kennzeichnung mit Sterilisations- und Freigabedatum ist unerlässlich, um den Verwendungszeitraum exakt zu überwachen und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Viele Praxen setzen hier auf digitale Lagerverwaltungssysteme, die den Bestand in Echtzeit dokumentieren.Zugriff und Transport
Der Lagerbereich sollte so angelegt sein, dass häufig benötigte Instrumente schnell erreichbar sind, ohne dass dabei andere Verpackungseinheiten unnötig bewegt werden müssen. Für Notfallinstrumentarien ist ein gesonderter, sofort zugänglicher Platz einzuplanen. Beim Transport zu den Behandlungsräumen sind geschlossene, desinfizierbare Transportbehälter zu verwenden, die sowohl vor physischer Beschädigung als auch vor mikrobieller Kontamination schützen.Qualitätssicherung und Dokumentationssysteme
Wesentliche Elemente eines funktionierenden Qualitätssicherungssystems:
- Regelmäßige Validierung aller Aufbereitungsgeräte
- Dokumentierte Wartung und Funktionsprüfungen
- Prozessüberwachung mit chem. und biologischen Indikatoren
- Digitale Erfassung aller Arbeitsschritte für Rückverfolgbarkeit
- Getrennte Nachweise für unterschiedl. Instrumentengruppen
- Regelmäßige Mitarbeiterschulungen und Kompetenznachweise
- Integration aktueller Fachgesellschafts-Leitlinien
- Sofortige Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen

Die Qualitätssicherung ist das Rückgrat einer jeden Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP). Sie stellt sicher, dass alle hygienischen, technischen und organisatorischen Vorgaben dauerhaft eingehalten werden – unabhängig von Personalwechseln, Arbeitsbelastung oder Praxisgröße. Ein konsequent umgesetztes Qualitätssystem ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch entscheidend für die Patientensicherheit und die Reputation der Praxis.
Validierung und Geräteprüfungen
Thermodesinfektoren, Sterilisatoren, Ultraschallbäder, Foliensiegelgeräte und weitere Aufbereitungsgeräte müssen in festgelegten Intervallen validiert werden. Diese Validierungen stellen sicher, dass die Geräte unter realen Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten und alle erforderlichen Prozessparameter einhalten. Neben der Initialvalidierung sind Wiederholungsvalidierungen in regelmäßigen Abständen (meist jährlich) durchzuführen. Zusätzlich ist eine dokumentierte Wartung Pflicht, um Ausfälle oder Qualitätsabweichungen frühzeitig zu erkennen.Prozesskontrollen im Arbeitsalltag
Auch im laufenden Betrieb müssen alle Arbeitsschritte überwacht werden. Sichtprüfungen auf Sauberkeit und Unversehrtheit, Indikatortests für Sterilisationsprozesse und chemische Schnelltests zur Überprüfung der Reinigungsleistung gehören zum Standard. Für Endoskope und Mikroinstrumente sind spezielle Funktionsprüfungen erforderlich, um kleinste Defekte zu erkennen, die die Patientensicherheit beeinträchtigen könnten.Lückenlose Dokumentation
Jeder Schritt im Aufbereitungsprozess – von der Annahme kontaminierter Instrumente bis zur Freigabe des Sterilguts – muss nachvollziehbar dokumentiert sein. Digitale Dokumentationssysteme bieten hier klare Vorteile: Sie minimieren den Zeitaufwand, ermöglichen eine sofortige Rückverfolgbarkeit und erleichtern interne wie externe Audits. Neben der Erfassung der Prozessdaten können auch Wartungsprotokolle, Validierungsnachweise und Schulungsunterlagen zentral hinterlegt werden.Personalqualifikation und Schulung
Qualitätssicherung hängt maßgeblich vom Wissen und der Sorgfalt des Personals ab. Regelmäßige Fortbildungen zu Hygienevorschriften, Geräteeinsatz und Arbeitssicherheit sind daher unverzichtbar. Neue Mitarbeiter müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eingehend geschult werden, um sicherzustellen, dass die Abläufe von Anfang an korrekt eingehalten werden.Planungsübersicht für die Aufbereitungseinheit – Checkliste
Planungscheckliste – Kernelemente im Überblick
- Bauordnung, RKI/KRINKO-Empfehlungen, Leitlinien
- Unrein-/Rein-Trennung, spezielle Zonen, ausreichende Flächen
- Zentrale Lage, kurze, patientenfreie Wege
- Beleuchtung, Lüftung, Anschlüsse, Geräteausstattung
- Desinfektionsmittelfeste Oberflächen, fugenlos, rutschfest
- Ergonomische, modulare, prozessoptimierte Arbeitsflächen
- Lagerung: Staubschutz, Klimakontrolle, Trennung nach Gruppen
- Validierung, Dokumentation, Schulung zur Qualitätssicherung

Eine durchdachte Planung ist der Schlüssel für eine funktionierende, sichere und effiziente Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP). Sie verbindet bauliche, technische, organisatorische und hygienische Anforderungen zu einem schlüssigen Gesamtkonzept. Die nachfolgende Übersicht fasst alle zentralen Planungsaspekte zusammen und dient als praxisnaher Leitfaden für Neubauten, Umbauten oder die Optimierung bestehender Praxisstrukturen.
Rechtliche Anforderungen
- Die Einhaltung aller relevanten Vorschriften ist die Basis jeder Planung. Dazu gehören Landesbauordnungen, Arbeitsschutzvorgaben, das Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) sowie die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am Robert Koch-Institut. Auch branchenspezifische Leitlinien von Fachgesellschaften und die DIN-Normen für Geräteausstattung sind verbindlich zu berücksichtigen.
AEMP Raumaufteilung mit Zonen
- Ein funktionaler Aufbereitungsraum ist in einen unreinen und einen reinen Bereich unterteilt, um Kreuzkontaminationen auszuschließen. Spezielle Zonen für empfindliche Instrumente wie Endoskope oder Mikroinstrumente sorgen für sicheren Umgang. Die Flächengröße richtet sich nach dem Instrumentenaufkommen und den eingesetzten Aufbereitungsverfahren.
Standort und Logistik
- Die Position des Aufbereitungsraums innerhalb der Praxis beeinflusst maßgeblich die Arbeitsabläufe. Eine zentrale Lage mit kurzen Wegen zu allen relevanten Behandlungsräumen minimiert Transportzeiten. Wo möglich, sollten direkte, patientenfreie Transportwege eingerichtet werden.
Technische Ausstattung für die Aufbereitungseinheit
- Von der Beleuchtung nach DIN EN 12464-1 über die Raumlufttechnik mit HEPA-Filtern bis zu den notwendigen Anschlüssen für Strom, Wasser, Druckluft und Daten – alle technischen Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein. Geräte wie Thermodesinfektoren, Sterilisatoren, Ultraschallreiniger und Foliensiegelgeräte sind bedarfsgerecht zu dimensionieren.
Oberflächen und Einrichtung
- Hygienische Oberflächen wie fugenlose PVC-Böden, Edelstahl-Arbeitsflächen und chemikalienbeständige Möbel erleichtern die Reinigung und erhöhen die Lebensdauer der Ausstattung. Arbeitsflächen werden materialflussorientiert angeordnet und ergonomisch gestaltet.
Lagerung und Qualitätssicherung
- Sterilgutlager müssen staubgeschützt, trocken und gut belüftet sein. Eine klare Trennung nach Instrumentengruppen, eindeutige Kennzeichnung und digitale Rückverfolgung sichern die Prozessqualität. Ergänzend sorgen regelmäßige Validierungen, Geräteprüfungen und Mitarbeiterschulungen für langfristig stabile Hygienestandards.
KS Medizintechnik – Ihr Partner für die perfekte Aufbereitungseinheit
Mit über 100 Jahren Erfahrung im medizinischen Fachhandel ist KS Medizintechnik Ihr verlässlicher Partner für die Planung, Einrichtung und Ausstattung eines normgerechten Aufbereitungsraums in Arztpraxen und Kliniken. Wir begleiten Sie von der individuellen Konzeptentwicklung über die komplette Lieferung des Equipments – vom ergonomischen Mobiliar bis hin zu modernsten Aufbereitungsgeräten – bis zur Bereitstellung sämtlicher Verbrauchsmaterialien und Zubehör für Ihren Praxisalltag.
Ob Neubau, Modernisierung oder Erweiterung – mit KS Medizintechnik setzen Sie auf Fachwissen, Praxisnähe und ein lückenloses Serviceangebot aus einer Hand. Kontaktieren Sie uns noch heute, um gemeinsam Ihre maßgeschneiderte AEMP zu entwickeln – für maximale Hygiene, reibungslose Abläufe und die Sicherheit Ihrer Patienten. Unsere Lösungen: wirtschaftlich, zuverlässig, effizient und zukunftssicher.


Unser Technischer Kundendienst übernimmt die fachgerechte Installation, regelmäßige Wartung und schnelle Reparatur aller Geräte sowie sämtliche technischen Dienstleistungen, die für einen störungsfreien Betrieb notwendig sind. Damit gewährleisten wir, dass Ihre Aufbereitungseinheit jederzeit effizient, sicher und gesetzeskonform arbeitet.

Buchen Sie unseren Service für Melag Geräte gleich hier im KS-Onlineshop – BUNDESWEIT ZUM FESTPREIS – Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung sowie Validierung.
Buchen Sie unseren Service für Melag Geräte gleich hier im KS-Onlineshop – BUNDESWEIT ZUM FESTPREIS – Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung sowie Validierung.